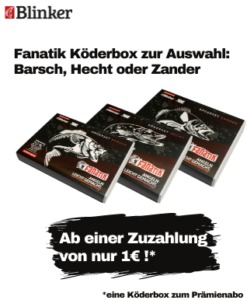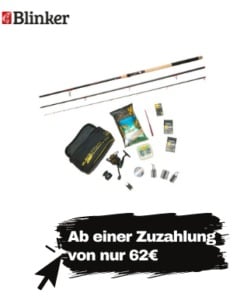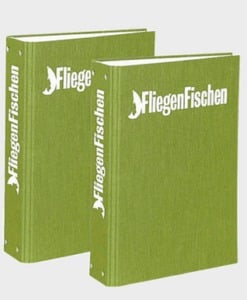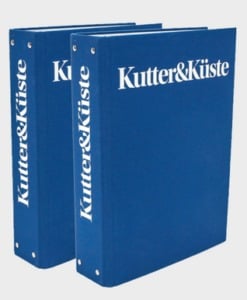Die EU ist gesetzlich verpflichtet, Fischerei nachhaltig zu betreiben und darf nicht mehr Fische entnehmen, als sich jährlich regenerieren können. Allerdings sind in den nordeuropäischen Gewässern etwa 70 Prozent der kommerziell befischten Bestände entweder überfischt, haben sich stark verringert oder sind völlig zusammengebrochen. Trotz umfangreicher wissenschaftlicher Daten und politischer Instrumente verfehlt die EU kontinuierlich ihre Ziele für nachhaltige Fischerei. Forschende des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und der Universität Kiel haben dies anhand der westlichen Ostsee untersucht.
Fischerei nachhaltig vs. profitorientiert: Kurzsichtige nationale Entscheidungen schädigen Bestände
Laut Dr. Rainer Froese, einem führenden Fischereiwissenschaftler, sind kurzfristige nationale Forderungen nach höheren, nicht nachhaltigen Fangquoten eine wesentliche Ursache für das Problem. „Umweltfaktoren wie steigende Wassertemperaturen und Sauerstoffverlust spielen ebenfalls eine Rolle, doch die Überfischung ist so gravierend, dass sie allein ausreicht, um Bestände zum Zusammenbruch zu bringen“, erklärt Froese. Der Vorschlag zur Verbesserung des EU-Fischereimanagements umfasst Maßnahmen, die im Rahmen der bestehenden Gesetze umgesetzt werden können und in wenigen Jahren rentable Fischerei mit gesunden Beständen ermöglichen.
Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der EU basiert auf der UN-Seerechtskonvention. Diese Konvention besagt, dass Fischpopulationen auf einem Niveau gehalten werden müssen, das maximale nachhaltige Fänge unterstützt. In Nordosteuropa wird dies durch gesetzlich bindende Höchstfangmengen umgesetzt, die zunächst vom Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) empfohlen werden. Dieser Rat besteht zu größten Teil aus Forschern verschiedener Fischerei-Institutionen. Auf Basis der Empfehlung des ICES schlägt die Europäische Kommission Fangquoten vor. Diese werden mit verschiedenen Ländern und Interessenvertretern diskutiert. Der Rat der EU-Fischereiminister*innen beschließt am Ende dann gesetzlich bindende Höchstfangmengen. Leider kommt es meist zu einer stetigen Erhöhung der Fangquoten während des Prozesses, sodass die letztendlich festgelegte Fangmenge die ursprünglich empfohlene deutlich übersteigt – mit dramatischen Folgen für die Bestände.
Überfischung in der westlichen Ostsee
Die westliche Ostsee ein Beispiel für die Dynamik zwischen Fischbeständen und Fischerei. Hier dominieren drei kommerziell wichtige Arten: Dorsch, Hering und Scholle. Langfristige Überfischung hat diese Bestände geschädigt, während weniger gefragte Arten, wie einige Plattfische stabil geblieben sind oder sogar im Bestand zugenommen haben. Im Jahr 2022 wurde weniger als ein Zehntel des potenziell nachhaltig fangbaren Fisches tatsächlich gefangen!

Bild: AdobeStock/Markus S.
Kleiner Lichtblick, aber auch nur Symptom des Problems: Kommerziell weniger interessante Arten blieben im Bestand stabil. Manche Plattfische etwa profitieren vermutlich auch von den niedrigen Dorsch-Beständen.
Phantom-Erholungen und immer höhere Quoten: Ein systematisches Problem
Die Bewertung von Beständen durch den ICES führte in der Vergangenheit schon mehrfach zu überoptimistischen Prognosen, die davon ausgingen, dass sich die Bestände erholen könnten, was in vielen Fällen nicht der Realität entsprach. Dies wird als „Phantom-Erholung“ bezeichnet. Die EU-Kommission schlug dann auf Basis der ohnehin schon zu hohen Schätzungen durch den ICES noch höhere Fangquoten vor, die vom EU-Rat der Fischereiminister*innen genehmigt oder gar nochmals erhöht wurden. Dieser Prozess begünstigt in jedem Schritt höhere Fänge, was zu Gesamtfangmengen (TACs) führt, die oft über dem liegen, was die Fischer tatsächlich fangen können. Besonders makaber: In manchen Jahren lag die gesetzlich erlaubte Höchstfangmenge durch all diese Faktoren vermutlich sogar höher, als überhaupt Fisch im Meer vorhanden war. De facto hätte also in diesen Jahren legalerweise jeder einzelne Fisch gefangen werden dürfen, ohne auch nur gegen die Quoten zu verstoßen.

Bild: AdobeStock/Conny Pokorny
Die Falschbewertung von Fischbeständen und die rücksichtslose Erhöhung von Fangquoten entgegen wissenschaftlicher Empfehlungen haben Spuren hinterlassen: Die meisten Fischbestände sind überfischt. Dabei könnte man nach Meinung der Forscher bereits innerhalb weniger Jahre eine nachhaltige Fischerei aus gesunden Beständen implementieren.
Froese merkt an: „Interessanterweise blieben die tatsächlichen Fänge oft unter diesen überhöhten Quoten – einfach weil die Fischer aufhörten zu fischen, wenn die Kosten für die Jagd nach dem letzten Fisch den Wert des Fangs überstiegen.“ Die Logik dahinter ist einfach: Sind weniger Fische vorhanden, muss mehr Aufwand betrieben werden, um genauso viel zu fangen – der Aufwand pro Fisch steigt, bis sich das Geschäft nicht mehr lohnt.
Nachhaltig: Forscher empfehlen unabhängige Institution für Fischerei-Quoten
Die Forscher schlagen vor, eine neue politisch unabhängige Institution zu schaffen, die fundierte wissenschaftliche Schätzungen für nachhaltige Jahresfänge erstellen kann. Dies würde es der EU ermöglichen, ihre eigenen Gesetze effektiv umzusetzen und die Überfischung zu beenden. „Um erfolgreich zu sein, muss eine solche Institution unabhängig agieren, ähnlich einer Zentralbank“, betont Froese. Um die Fischerei nachhaltig zu gestalten, muss die EU ihre Ziele ernst nehmen und die gemeinsame Fischereipolitik entsprechend umsetzen. Durch die Implementierung fundierter wissenschaftlicher Beratung könnten in vielen Fällen profitable Fischereien aus großen Fischbeständen in gesunden europäischen Gewässern innerhalb weniger Jahre entstehen.
Auch interessant
- Angeln allgemein1,8 Tonnen Aal für die Elbe
- Angeln allgemeinEU berät heute: Fangquote 2026 für Berufsfischer
- Angeln allgemeinFangen mit LED: Innovative Ansätze für nachhaltige Fischereien
- MeeresangelnGrundschleppnetze verbieten
Quelle: SciTechDaily
Rainer Froese, Noa Steiner, Eva Papaioannou, Liam MacNeil, Thorsten B. H. Reusch, Marco Scotti. Systemic failure of European fisheries management. Science, 2025; 388 (6749): 826 DOI: 10.1126/science.adv4341