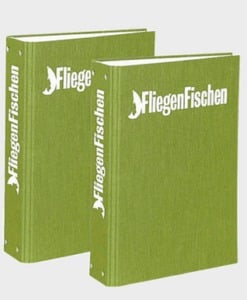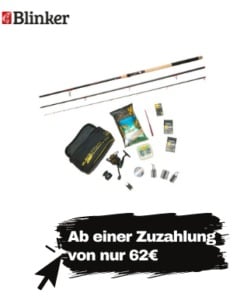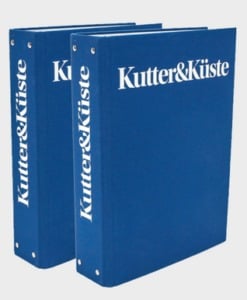Viele Fliegenfischer träumen von der einen Fliege, die unter allen Bedingungen fängt – und viele Angler haben ihre eigenen Lieblingsmuster. Zudem entstehen Jahr für Jahr neue Designs, doch schöne Designs allein bringen noch keinen Fisch. Eine Trockenfliege muss in erster Linie gut schwimmen. Und das macht sie aus zwei Gründen: durch Auftrieb oder durch Ausnutzung der Oberflächenspannung des Wassers. Doch dazu später mehr.

Bild: J. Klingberg
Beim klassischen Bootsangeln werden kurze Würfe mit einem kräftigen Vorfach kombiniert. Stark überhechelte Fliegen verdrehen das Vorfach kaum – und bleiben für Fische unter der Oberfläche gut sichtbar.
Ein Beispiel für eine „Lieblingsfliege“ ist die einst populäre Européa-12. Die Europa 12 ist eine der beliebtesten Fliegen in Schweden, zeigte jedoch Schwächen wie das Verdrehen der Vorfachspitze und eine begrenzte Schwimmfähigkeit. Ganz anders die Streaking Caddis – auch nach mehreren Einsätzen blieb sie zuverlässig schwimmfähig und stabil im Wurf, dank einer durchdachten Bindeweise. Und das ist der entscheidende Punkt: Besonders bei Trockenfliegen ist die Materialwahl beim Binden entscheidend. Sie beeinflusst maßgeblich das Schwimmverhalten der Fliegen. Materialien, die stark Wasser aufnehmen, sind für Trockenfliegen ungeeignet. Probleme entstehen häufig, wenn Trockenfliegen in ungeeigneten Strömungsverhältnissen eingesetzt werden. Die meisten Fliegen sind für ganz bestimmte Gewässer konzipiert – etwa für schnelle Strömungen, ruhige Zonen oder stehende Gewässer. Werden sie falsch verwendet, sinken sie zu früh oder verhalten sich unnatürlich im Wasser.
Denn jede Fliege ist nicht nur ein Köder, sondern auch das Ergebnis ihrer Herkunft – angepasst an Strömung, Struktur und regionale Bedingungen. Wer diese Herkunft versteht, trifft am Wasser meist die bessere Wahl.
Bewährte Trockenfliegen: Hechelfliegen
Ein gutes Beispiel für solche angepassten Muster sind klassische Hechelfliegen. Sie nutzen die Oberflächenspannung des Wassers, um auf der Oberfläche zu bleiben, und sind weltweit im Einsatz und haben sich über Jahrzehnte bewährt – in unterschiedlichsten Regionen und Gewässertypen. Unter Hechelfliegen versteht man alle Trockenfliegen mit Hechel, die nicht nur Auftrieb geben, sondern auch Bewegung imitieren.
Besonders in der schottischen und irischen Stillwasserfischerei kommen buschige Front- und Körperhechel zum Einsatz. Vom Boot aus werden sie als sogenannte „Top droppers“ gefischt, meist zusammen mit ein bis zwei Nassfliegen am Vorfach. Beim „Dapping“ wird die Fliege vom Wind über die Wasseroberfläche getragen – flatternd wie ein lebendes Insekt. Die dichte Fronthechel wirkt dabei wie ein Windfänger und verhindert das Durchnässen.
In der Strömung sorgt das Verhältnis von großer Auflagefläche zu geringem Gewicht bei Hechelfliegen für guten Auftrieb. Während britische Muster oft locker gehechelt sind – passend zu den ruhigen Kreideflüssen – bevorzugen amerikanische Angler dichtere Versionen, die besser mit turbulenten Strömungen zurechtkommen.

Bild: J. Klingberg
CDC-Trockenfliegen nutzen die besonderen Eigenschaften der Entenbürzelfedern: Zwischen ihren feinen Fasern halten sich Mikro-Luftbläschen – sie wirken wie winzige Schwimmreifen und sorgen für exzellente Schwimmfähigkeit.
Bereits ab den 1940er-Jahren wurden in den USA spezielle Hecheln gezielt gezüchtet – etwa von Harry Darbee in Livingston Manor. Diese Hecheln lieferten besonders dichte, stabile Fibern, die ideal für Fliegen in schnell strömenden Gewässern waren. Solche Muster eignen sich hervorragend für kurzes, präzises Werfen unter schwierigen Bedingungen. In solchen Situationen darf das Vorfach ruhig etwas stärker dimensioniert sein (0,20-0,25 mm), da der Abdruck auf der Wasseroberfläche kaum eine Rolle spielt.
Ein häufiger Fehler: Hechelfliegen als Weitwurf-Fliegen mit dünnen Vorfach- spitzen einzusetzen – das funktioniert meist nicht. Wieder zur Européa-12, ein altes Muster, das bereits vor dem Zweiten Weltkrieg von der französischen Firma Mouches Ragot produziert wurde. Die Stärke dieses Musters liegt in den Hecheln. Die Fliege besitzt eine recht buschige Hechel und eignet sich gut für die Fischerei in starker Strömung. Wird sie jedoch in ruhigem Wasser eingesetzt, empfiehlt es sich, die Hechel an der Unterseite etwas zu stutzen – das verhindert das Verdrehen des Vorfachs und verbessert das Absetzen auf der Wasseroberfläche.
Parachute-Fliege oder auch Fallschirmfliege
Parachutefliegen (Fallschirmfliegen): Auch hier sind Hecheln im Spiel, auch sie nutzen die Oberflächenspannung des Wassers. Parachute Fliegen fangen am besten, wenn der Körper im Film hängt. Daher fettet man da nur den Flügel (Wingpost) und die Hechel. Das erhöht die Tragfähigkeit der Fibern über ihre gesamte Länge. Obwohl erste Muster über 100 Jahre alt sind, etablierten sich die Parachutefliegen erst in den 1970er-Jahren. In den 1980ern wurden sie besonders für das Fischen mit langen, feinen Vorfachspitzen in ruhigen Flussabschnitten beliebt. Die niedrige Silhouette ist schwer zu sehen, aber die Fliege dreht sich kaum beim Werfen und hinterlässt ein zartes, aber breites Oberflächenbild. Sie eignet sich besonders gut für Spent Spinner, bei denen die gespreizten Flügel durch die horizontalen Fasern simuliert werden. Auch beim Stillwasserfischen sind sie beliebt, da sie gut mit dünner Vorfachspitze weit geworfen werden können.

Bild: J. Klingberg
Parachute Fliegen: Die waagrecht eingebundene Hackle wirkt wie ein Fallschirm – sorgt für perfekte Lage auf dem Wasser und hervorragende Schwimmeigenschaften, selbst in rauer Strömung.
CDC-Fliege: Die Fliege besteht aus „Cul de Canard“
CDC-Fliegen: Diese Fliegen bestehen meist vollständig aus „Cul de Canard“ (CDC) – der besonders schwimmfähigen Feder aus der Bürzelregion der Ente. Und sie ahnen schon: Auch diese Fliegen nutzen die Oberflächenspannung des Wassers. Die Abkürzung stammt aus dem Französischen und bezeichnet das Hinterteil der Ente. In diesem Bereich besitzen Wasservögel eine spezielle Drüse, mit deren Fett sie ihr Gefieder pflegen und wasserabweisend halten. Diese feinen, flauschigen Federn mit natürlichem Fettgehalt bieten eine außergewöhnlich hohe Schwimmfähigkeit und werden von Bindern wegen ihrer feingliedrigen Struktur geschätzt. Sie verleihen der Fliege eine natürliche Silhouette.
Die Konstruktion basiert auf geringer Dichte und breiter Auflagefläche. Solange die Fliege trocken bleibt, schwimmt sie zuverlässig. In klaren, langsamen Fließgewässern sind sie besonders wirkungsvoll: Sie lassen sich mit langen, feinen Vorfachspitzen gut präsentieren, ohne sich beim Wurf zu verdrehen. Früher galt CDC als unsinkbar – inzwischen weiß man: Auch dieses Material muss wie andere imprägniert werden. Zwei Gründe machen CDC-Fliegen beliebt: Sie erzeugen ein sehr feines, realistisches Oberflächenbild (ähnlich einer Eintagsfliege) und reflektieren Licht in den feinen Fibern, was sie besonders transparent und natürlich wirken lässt. In schneller Strömung jedoch sind sie oft zu unauffällig.
Daneben gibt es No Hackle- oder Foam-Fliegen. Bei diesen sorgen Schaumstoffkörper für den Auftrieb und dauerhaftes Schwimmen, ideal für Landinsektenmuster. Käfer und Heuschrecken sind die typischen Imitationen. Die Foam-Fliegen nutzen NICHT die Oberflächenspannung des Wassers, sie schwimmen, weil sie eine geringere Dichte als das Wasser haben. Fliegen mit Schwimmweste, sozusagen.

Bild: J. Klingberg
No-Hackle-Trockenfliegen verzichten auf einen Hechelkranz und wirken dadurch besonders dezent.
Der Glaube an ein bestimmtes Muster ist zwar hilfreich für das Vertrauen beim Fischen, doch entscheidend ist die Bindeweise. Eine Fliege, die für langsames Wasser gebunden ist, funktioniert in schneller Strömung oft nicht – und umgekehrt. Wer die Bindeweise und ihre Funktion kennt, kann mit weniger Mustern erfolgreicher fischen – und spart sich die ständige Suche nach der „Wunderfliege“.

Bild: J. Klingberg
Fliegenfischen im See: Auf einer ruhigen Wasseroberfläche empfiehlt sich die Verwendung einer dünnen Vorfachspitze in Kombination mit einer No-Hackle-Fliege. Die Fliegen verdrehen das Vorfach selbst bei weiten Würfen kaum.
Auch interessant
- FliegenfischenFrosch-Streamer: Darauf sind Hechte und Forellen scharf
- FliegenfischenPraxis Heuschrecken – Begegnungen mit kapitalen Forellen